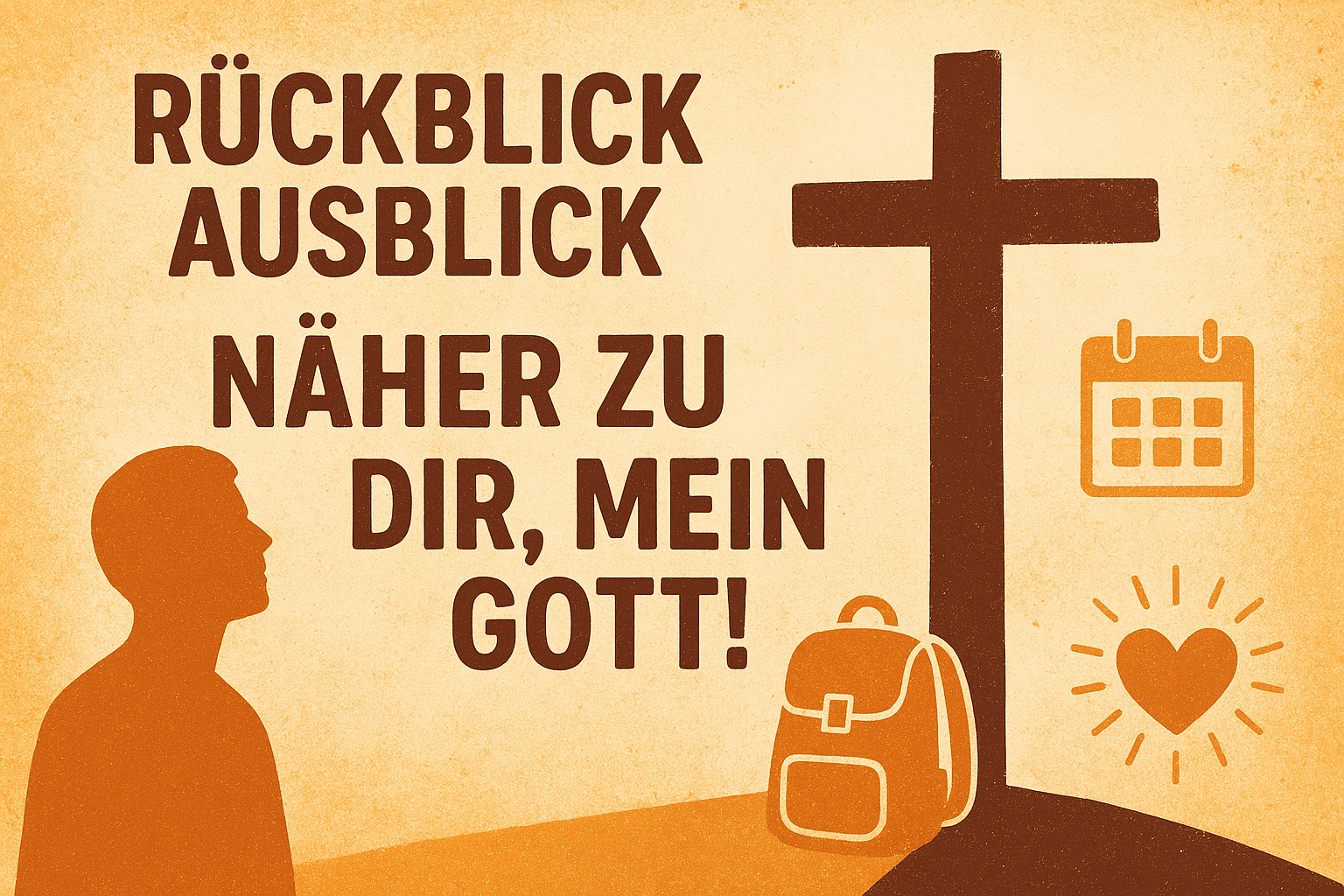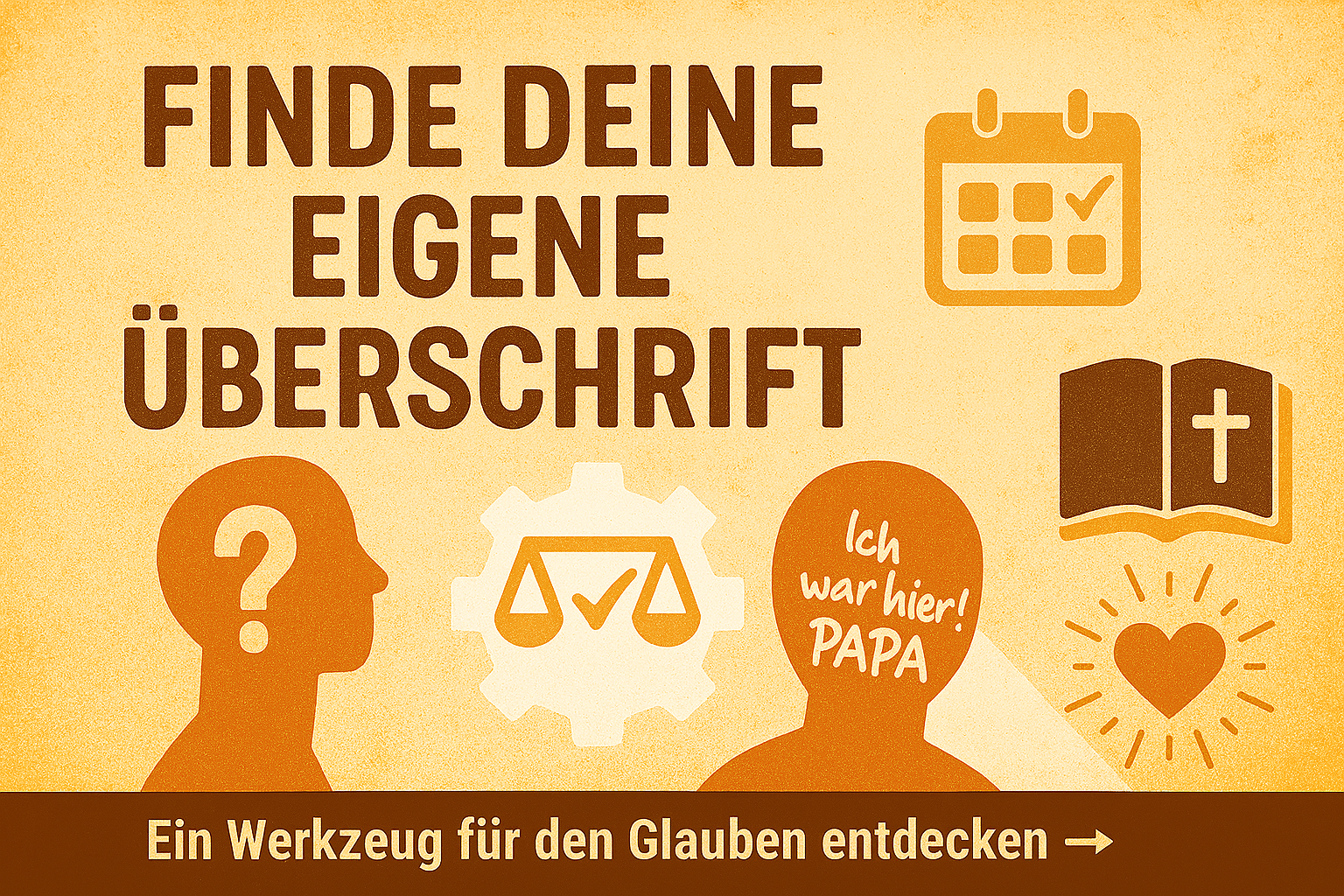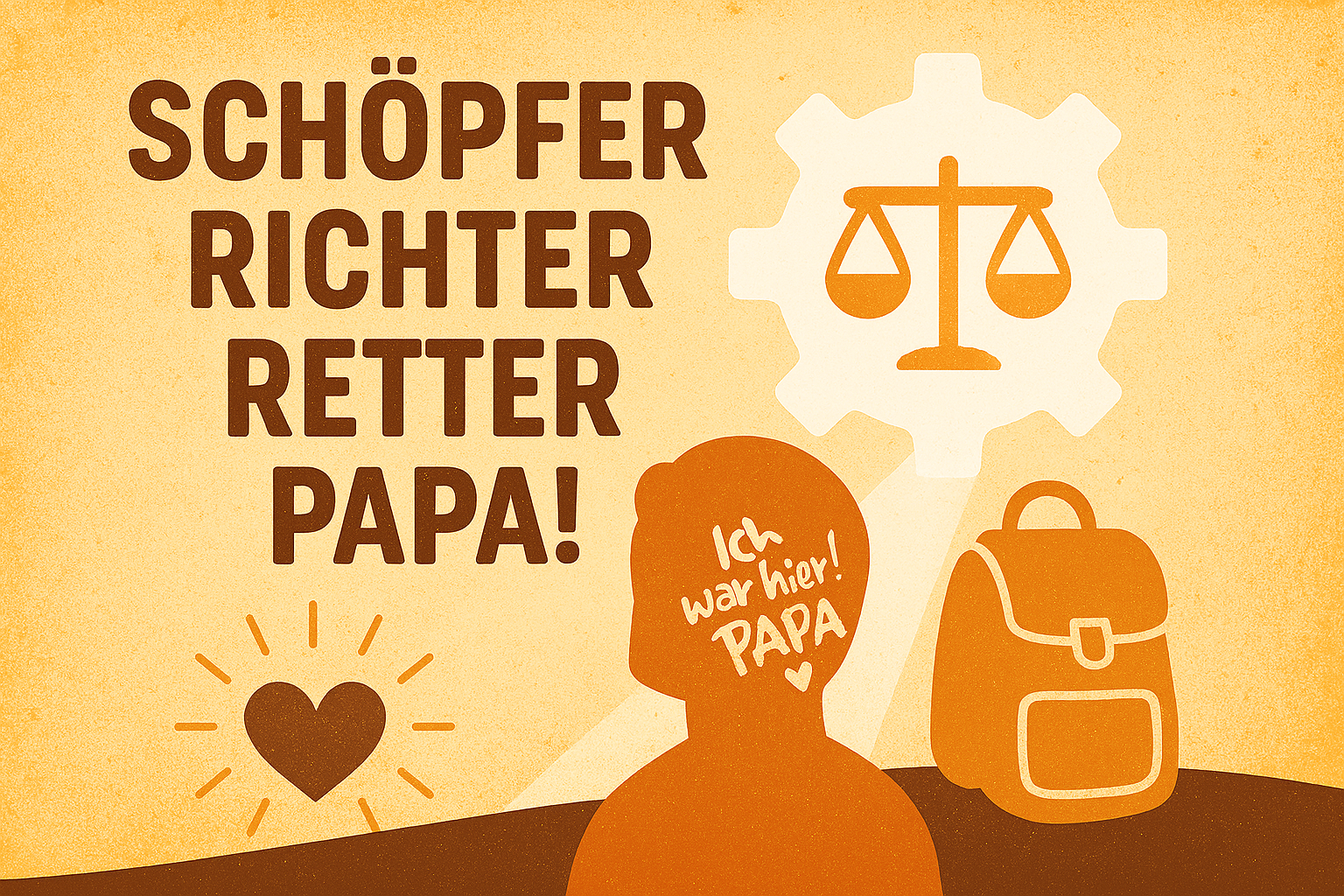Wie recht Paulus hier hat! Allerdings erscheint es mir immer wieder zweifelhaft, ob wir die Tragweite dieser Erkenntnis wirklich erfasst haben.
Es fängt damit an, dass Jesus am Kreuz den jüdischen Glauben nicht abgelöst, sondern bestätigt – weil erfüllt – hat. Dass die Glaubensführer jener Zeit (und wohl auch große Teile des von ihnen geführten Gottesvolkes) dies nicht begriffen haben steht auf einem anderen Blatt. Mit dem Leben, Sterben und der Auferstehung Jesu hat Gott aber alles erfüllt, was er seinem Volk einst versprochen hatte.
Dass mit Jesus die Amts-Priesterschaft abgeschafft wurde, war daher keine Strafe für ihren Ungehorsam; sie war einfach überflüssig geworden, weil es jetzt den perfekten Hohepriester zwischen Gott und den Menschen gab und immer noch gibt.
Eindeutig wurde aber die (jüdische) Amtskirche abgeschafft, denn ihre Aufgabe war getan, als Gott durch Jesus seinen Bund mit Israel erfüllt hatte. An ihre Stelle trat das ewige Bündnis Gottes mit seinem Volk (das nun die ganze Welt umfasst), begründet allein durch deren Glauben an Christus. Wenn ich mich heute in den christlichen Glaubensgemeinschaften umsehe, so entdecke ich sie aber vielfältig wieder, die Amtskirche – die katholische ist hier nur der größte (und historisch älteste) Block. Wie kann das sein?
Die Amtskirche begründet dies mit dem Willen unseres Herrn, der ja in Petrus und den Aposteln eine neue Amtskirche gegründet hätte. Das ist soweit falsch! Er hat die Apostel ausgesandt, sein Evangelium zu verkünden, die Sünden zu vergeben und die Gläubigen zu taufen. Und genau das haben sie auch getan. Die Gemeinschaft der Gläubigen ist die einzige Kirche, die Jesus im Sinn hatte. Petrus hatte unter den Aposteln wohl die Aufgabe, den Haufen als Person und unter dem eben gerade erkannten Glauben an Jesus Christus zusammenzuhalten. Doch dass hier insgesamt eine sehr flache Hierarchie herrschte, erkennen wir bereits daran, dass sich Paulus vom gesamten Gremium die Sendung als Missionar geben ließ und dass er seine Interpretation dieser Botschaft für die Heiden vom gesamten Gremium genehmigen ließ. Petrus hätte sich mit Händen und Füßen gegen Anreden wie „Heiliger Vater“ oder gar „Eure Heiligkeit“ gewehrt. Er war Petrus – das war der Name, den Jesus ihm gegeben hatte und Petrus war damit die offizielle Anrede.
Auch die Gemeinden der ersten paar hundert Jahre waren einzelne, selbstständige Gruppen, einzig vernetzt durch den gemeinsamen Glauben und die römischen Straßen im gesamten Reich. Eine Art „Vereinigung“ erfuhren sie erst, als der christliche Glaube zur römischen Staatsreligion erhoben wurde. Und erst dann, als Organ eines Staates, war eine Amtskirche notwendig geworden. Und erst mit der Amtskirche waren gemeinsame Festtage und andere Rituale sinnvoll und überhaupt erst organisierbar geworden. Erst mit der Amtskirche entstand eine einheitliche christliche Religion. Neben der Haltung jedes Christen, die Jesus uns lehrt, gibt es seitdem auch eine offizielle Handlungsanweisung, welche Dinge ein Christ zu verrichten hat, wenn er Christ im Sinne der/einer Amtskirche (und nicht „nur“ im Sinne Christi) sein möchte.
Ist die entstandene Religion aus dem Heiligen Geist heraus entstanden, also der Wille Gottes?
Es scheint zumindest, dass Gott nichts dagegen hat, wenn wir diesen weltumspannenden Laden professionell organisieren und mit wiedererkennbaren Zeichen ausstatten möchten. Mit seinen eigenen Fingern in Steintafeln geschrieben hat er das aber nicht!
Und so gilt für uns, was Paulus sinngemäß sagte: Ein jeder diene den anderen, die Priester und Ältesten ihrer Gemeinde und alle dienen unserem Herrn. Und was ist mit den Bischöfen? Sie können nicht über den Glauben der Gläubigen wachen, denn sie kennen sie nicht und auch nicht ihre Beweggründe. Jede Gemeinde schart sich um ihren Priester und ihre Ältesten (modern: Gemeindeteam). Das ist die für jeden Einzelnen einzig erlebbare Gemeinschaft, darüber hinaus wird es abstrakt. Warum steht/stehen ein Priester und/oder Älteste der Gemeinde vor? Weil sich Menschen immer nur um Menschen scharen können, sie brauchen einen sichtbaren, einen greifbaren Anker – jemand der hörbar antwortet, wenn sie fragen (Seelsorge). Sie brauchen auch jemanden, der die Dinge so gut es geht ordnet (Organisation). Eine Person und/oder eine Gruppe, die das in einer Gemeinde leisten kann (weil sie es kann und weil die Gemeinde sie respektiert) hat priesterliche Aufgaben in dieser Gemeinde.
Hier hätten wir dann eine wirklich wichtige Aufgabe für einen Bischof, also die Diözese. Diese Organisationseinheit erkennt den Bedarf der Gemeinden an „Hirten“ (die das dorthin melden) und sie organisiert und entsendet „Hirten“, dort wo sie fehlen (wenn freie vorhanden!). Es kann nicht schaden, für den/die Entsendete(n) den Segen Gottes zu erbitten. Eine Alternative wäre eine Stellenausschreibung der jeweiligen Gemeinde, wie dies in der evangelischen Kirche üblich ist.
Wichtig ist nicht, dass die entsandte Person vom Bischof geweiht ist, wichtig ist, dass sie von der Gemeinde angenommen wird. Priester müssen von ihrer Gemeinde angenommen werden. Gelingt ihnen das nicht, hilft ihnen auch die Weihe des Bischofs nicht dabei!
Gelingt es ihnen aber, so sind sie Priester der jeweiligen Gemeinde und nicht des Bischofs, der sie entsandt hat!
Es mag ja sein, dass das Kirchenrecht hier etwas anderes sagt, aber ein unsinniges Recht kann Fakten nicht ändern! Wenn es zwischen Priester und Gemeinde nicht funktioniert, dann hat die Gemeinde keinen Hirten, selbst wenn sie einen Priester hat. Und hat die Gemeinde ihren Hirten gefunden und angenommen, dann hat Gott entschieden und der Bischof ist aus dem Spiel.
Dies ist dann wichtig zu verstehen, wenn es zum Beispiel zum Streit zwischen einzelnen Gemeindemitgliedern und diesem Priester kommt. Paulus sagt hier sinngemäß: In diesem Fall sprecht zunächst unter vier Augen. Wenn das zu keinem Ergebnis führt, holt – wenn nötig – einen Zeugen dazu und bindet die Ältesten in den Streit mit ein. Erst wenn es auch hier keine Einigung gibt, kann man die Diözese (als organisatorisch übergeordnete Stelle) um Hilfe bitten. Diese wird aber nicht den in der Gemeinde respektierten Priester abberufen, denn es ist ja nicht mehr „ihr“ Priester. Sie wird versuchen zu vermitteln. Hierfür gibt es Profis, Mediatoren, die gelernt haben zu vermitteln.
Und wenn die Mediation auch scheitert?
Dann ist der Priester Hirte der Gemeinde. Er kann aber aus verständlichen Gründen nicht mehr der Hirte der mit ihm im Streit befindlichen Personen sein. Christus mahnt uns zur Versöhnung. Wir müssen einsehen, dass Menschen nicht immer dazu in der Lage sind.
Alle müssen aber auch einsehen: Ein Hirte für eine Gemeinde ist ein Geschenk Gottes, keine Leistung der Diözese. Er kann daher nicht (von Menschen) abberufen werden, wenn er oder die Gemeinde das nicht wünscht. Wenn hier ein Bischof gegen den Willen der Beteiligten handelt, versteht er den Priester als Diener der Diözese (oder gar des Bischofs) und nicht als Diener Gottes für die Gemeinde.
Ein Kirchenrecht, das diese Gewichtung in der Berufung (erst Gott, dann die Gemeinde, dann der Bischof) nicht erkennt und nicht anerkennt, ist in seinem Konzept und seinem Selbstverständnis falsch. Wie falsch das ist, erkennen wir dann, wenn dieses Kirchenrecht von einzelnen dazu missbraucht wird, ihren Willen in einer Gemeinde durchzusetzen und die Diözese hier – gemäß dem Kirchenrecht – mitspielt.