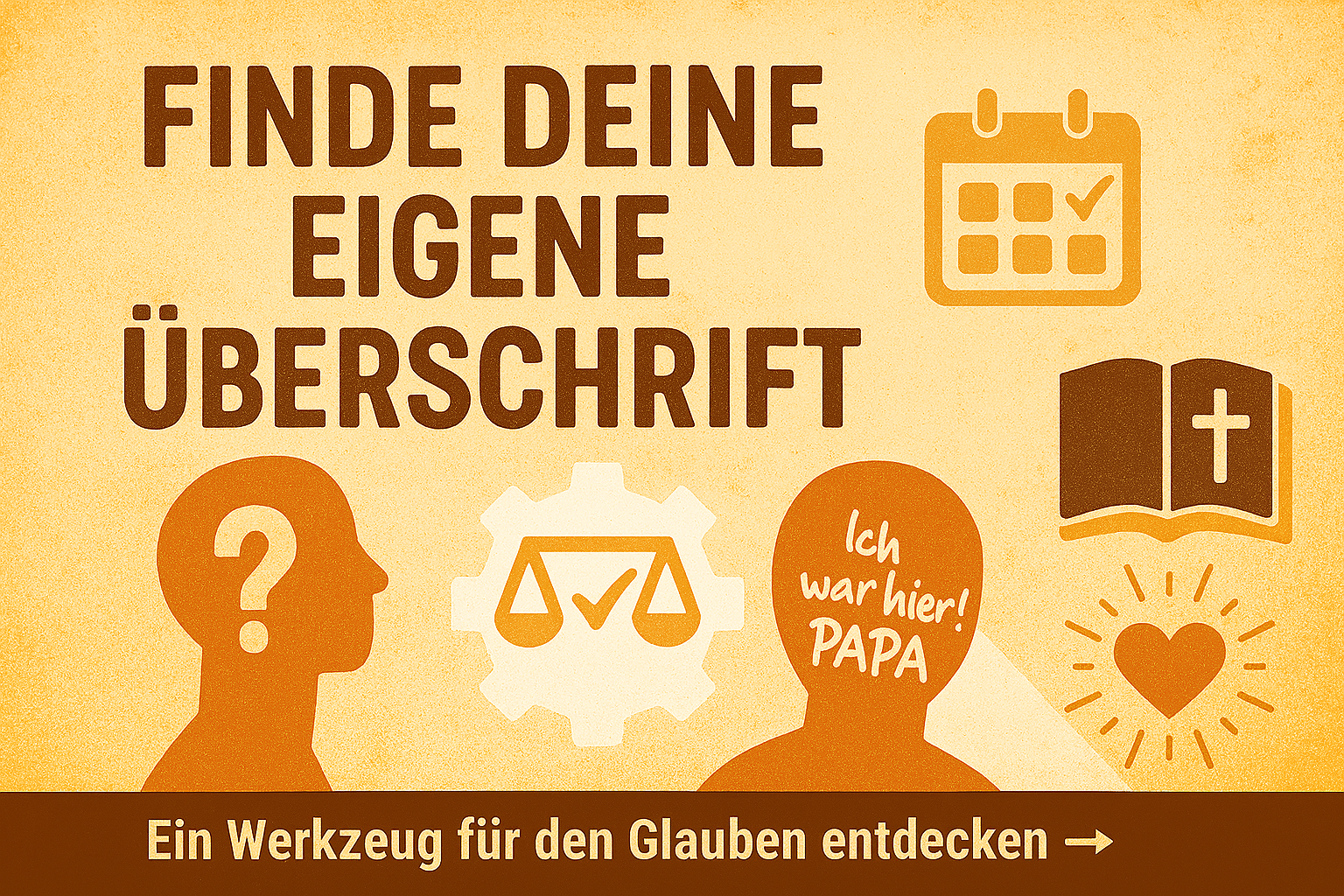Gott ist immer derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit! Aber das gilt nicht für seine Kirche, denn die besteht aus den Menschen, die sie bilden. Und Menschen verändern, entwickeln sich – das ist ganz offensichtlich auch der Wille Gottes. Wie könnte die Kirche dann immer dieselbe bleiben? Die Kirche entwickelt sich ständig weiter.
Die Vorgeschichte
Die Vorgeschichte der Kirche liegt in „grauer Vorzeit“. Die Überlieferungen geben uns aus jener Zeit wenig Konkretes. Adam und Eva und alle in der Bibel genannten Personen vor Abraham sind wohl mehr oder weniger sicher mythische Gestalten, die das frühe Auf und Ab in der Beziehung zwischen Gott und seinen Kindern beschreiben. Aber wie ist es mit dem „Urvater“ Abraham? Historisch oder mythisch? Ist Noah historisch oder mythisch? Sind Jakob und seine Nachkommen historisch oder mythisch? Wir wissen es nicht! Sie markieren Fixpunkte in der Beziehung zwischen Gott und seinen Kindern. Hier hat sich in der Beziehung etwas Wesentliches geändert. In Abraham erklärt Gott im Grunde die Menschheit zu seinen Kindern, wohl nicht jeden einzelnen Menschen aber viele davon, viel mehr, als wir uns mit unserem engen Verstand vorstellen können. Bei Noah säuft praktisch die ganze Schöpfung ab. Es handelt sich hier sogar noch nicht einmal um eine ursprünglich biblische Erzählung, die Hebräer haben sie älteren Schriften entnommen (wie vermutlich auch die Schöpfungsgeschichte). Auch wenn sich die Geschichte wie ein großes, vom Himmel gekommenes Abschlachten liest, im Kern schließt und bekräftigt Gott mit den Menschen den schon Abraham zugesagten Bund. Hier wird auch schon deutlich: In der Bibel sollten wir uns nicht von den oft martialischen Bildern täuschen lassen, sondern sollten auf die dahinterstehende Aussage achten. So stellt eben auch schon der Anfang der Bibel nicht fest, dass die Sünde durch die Frau in die Welt kam, sondern durch den Wunsch des Menschen wie Gott sein zu wollen oder anders ausgedrückt: Der Mensch möchte selbst Gott sein und diese Rolle ist viele Nummern zu groß für ihn.
In der Vorgeschichte der Kirche geht es also um Menschen, die einen mehr oder weniger unbekannten und unpersönlichen Gott anbeten, der je nach Volk (oder später Nation) durch unterschiedliche Gestalten, Namen und Rituale in der Menschheit repräsentiert ist. Weil Menschen aber eine „Unperson“ nicht ansprechen können, machen sie sich Statuen und beten diese an. Praktisch alles Sichtbare konnte als Gottheit fungieren: Männer, Frauen, Tiere, Pflanzen, die Sterne und Planeten, der Mond usw. Was sich letzten Endes als Gottheit (oder auch Gottheiten) durchsetzte, hing von der aktuellen Kultur des jeweiligen Volkes ab.
Menschen können nur an etwas glauben, das sie sich irgendwie vorstellen können. Aber die Suche nach Gott begann wohl mit dem Tag, an dem der erste Mensch sich selbst erkannte. Ich muss meine eigene Begrenztheit erkennen, um mich fragen zu können: Gibt es noch etwas außerhalb der Grenzen meines Verstandes?
Und wo ist hier tatsächlich Gott? Das liegt im Auge des Betrachters.
Ich kann mich auf den Standpunkt stellen: Die Suche nach Gott kommt aus dem Menschen selbst. In dem Moment, da er sich als vom Rest isoliert empfindet, entsteht eine Lücke, die er mit einem Gott füllt.
Oder ich spule mal schnell bis zu den Paulus-Briefen vor und sage: „Denn Gott ist es, der in euch das Wollen und das Vollbringen bewirkt, noch über euren guten Willen hinaus.“ (Phil 2,14)
Hier ist Gott der Vater des Gedankens. Er lässt uns die Lücke erkennen und bewirkt so, dass wir anfangen, nach ihm zu suchen. Denn warum sollte der Mensch in einer Zeit, in der es nur ums nackte Überleben ging, nach etwas suchen, was ihn nicht satt machte und auch sonst nichts zu seiner aktuellen Existenz beitrug?
In beiden Fällen wird aber der Mensch auf seinem Weg und in seiner Entwicklung in dieser Welt Zeichen finden, die ihn in seiner Suche weiterbringen, die ihm neue Erkenntnisse über seinen Gott liefern – im ersten Fall, weil er das erwartet, im zweiten, weil sie tatsächlich da sind, wie der Gott, der ihn auf die Suche nach diesen Zeichen schickte.
Die Anfänge
Die Anfänge der Kirche beginnen tatsächlich mit Mose, denn hier passiert der größte Wendepunkt in der Entwicklung der Beziehung. Gott selbst wird zur Person! Zunächst in einem brennenden und doch nicht verbrennenden Dornenbusch in der Wüste. Gott stellt sich Mose als der Gott seiner Vorfahren vor und als „der Gott, der ist“. Das grenzt ihn in seinem Selbstverständnis von allen anderen Göttern jener Zeit ab. Er beschreibt sich als der, der ist, das heißt, die anderen sind nicht. Alle anderen Götter sind nicht, wenn du ihn als deinen Gott annimmst. Ein grundlegendes Statement, das die Hebräer wahrscheinlich nicht verstanden haben.
Du kannst mit deinem Gott reden, sogar mit ihm streiten, wenn zu unzufrieden oder klagen, wenn du traurig bist, aber er ist DER Gott, eine Person, der Einzige. Jeder kann persönlichen Kontakt zu dieser Person halten, der das möchte – das ist die entscheidend andere Eigenschaft eines persönlichen Gottes. Dieses besondere Angebot haben die Hebräer jedoch abgelehnt, das Buch Exodus erzählt davon. Sie wollten lieber keinen direkten Kontakt, also bekamen sie einen Mittler, einen Hohepriester, wie ihn alle anderen Religionen dieser Welt auch hatten.
Gleichzeitig gab es einen Satz neuer Regeln, die eben zuallererst festlegten: Gott ist nur einer. Andere Götter sind nicht! Nachdem dies geklärt ist, gibt dieser Gott noch Regeln im Umgang miteinander innerhalb des von ihm ausgewählten Volkes und im Umgang mit Menschen anderer Völker. Darüber hinaus erhalten die Israeliten natürlich auch Anweisungen für abzuhaltenden Rituale. Die Forderung nach einem Mittler macht deutlich, dass dieses Volk festgeschriebene Rituale braucht, die gemeinschaftsbildend sind und den Bund mit Gott regelmäßig erneuern. Die Geschichte der Israeliten zeigt, dass dies keine übertriebene Vorsicht war.
Die Anfänge der Kirche sind somit gekennzeichnet durch den persönlichen Gott, der die vielen verschiedenen Gottesbilder und -vorstellungen, die sich die Menschen geschaffen hatten, beendet, ein (neues) Gesetz (das ebenfalls alle alten ablöst), also ein Buch, das Regeln und Rituale festlegt und einen vom übrigen Volk abgegrenzten Priesterstand, der zwischen Gott und den Menschen vermittelt und über die Einhaltung der Regeln und Rituale wacht.
Die Kirche, das ist hier die Stiftshütte und das für die Aufgabe der Leitung und Kontrolle geweihte Personal. Das Volk Gottes ist hier nur Untertan, bestenfalls Gast. Nicht Gott, sondern die vom Volk geforderten Führer sprechen zu diesem und leiten es in Namen und Auftrag Gottes.
Der Aufstieg
Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne (Stufen, Hermann Hesse). So ging es auch den Israeliten. Doch nach der Staatsgründung Israels hören wir zunächst gar nicht mehr so viel vom Hohepriester. Es sind Richter, die in den verschiedenen Regionen über den Glauben wachen. Der Hohepriester rückt erst wieder ins Zentrum des Interesses, als die Israeliten auch einen König haben wollen, genau, wie alle anderen Völker um sie herum auch. Wenn man das so sehen möchte, geschieht hier die erste Dreiteilung der göttlichen Allmacht. Der König führt die Menschen, der Priester wacht über die Seelen und Gott steht über allem. Mit den Königen David und Salomo erreicht die alte Kirche den Höhepunkt ihrer Entwicklung. Sie hat jetzt eine fest in irdische Größen gepresste Form.
Der Niedergang
Nun unterschied sich rein äußerlich die jüdische Religion aber auch nicht mehr von den anderen Religionen. Es gibt einen König und Priester von Gottes Gnaden, sie vertreten die göttliche Macht auf Erden. Bis aufs Bilderverbot sind viele andere Religionen nach genau derselben Struktur aufgebaut. Dabei hat der König sogar größeren Einfluss, da er in den Alltag der Menschen hineinwirkt. Wenn er das grundsätzliche Statement „Unser Gott ist (nur) einer!“ nicht mehr so eng sieht und (auch) andere Götter zulässt oder sogar selbst anbetet, so wird sich das auch auf das Volk auswirken. Umgekehrt wird ein König in bestimmten Dingen den „Glaubensströmungen“ des Volkes auch nachgeben, wenn ihm das in der Erhaltung seiner Macht hilfreich erscheint. Gleichzeitig befinden sich auch König und Prieser in gegenseitiger Abhängigkeit, so dass die Priesterschaft als Korrektiv ausfällt. Keiner der ursprünglich Beauftragen wacht nun mehr über den Weg, alle treffen bevorzugt Entscheidungen, welche die Struktur und somit ihre Macht und ihren Einfluss sichern. Schon spätestens bei Salomo beginnt diese Abwärtsspirale.
Und Gott? Gott entsendet jetzt Propheten. Waren diese unter David und Salomo noch Berater des Königs, werden sie jetzt zu Wächtern über das Wort und zu Mahnern – und damit zur Bedrohung für die Mächtigen.
„Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die Boten, die zu dir gesandt sind.“ (Mt 23, 37)
Jesus bringt es auf den Punkt. Die Propheten gefährdeten mit ihren Worten die sorgfältig errichteten Mauern der Macht. Folgerichtig wurden sie von der Kirche (wir erinnern uns: In diesem Entwicklungsstadium der Kirche ist dies die geistliche und nach der Aufteilung in geistliche und weltliche Macht auch die weltliche Obrigkeit) verfolgt und als „Feinde des Staates“ (also nach damaligem Verständnis der Wahrheit) getötet, sobald man ihrer habhaft wurde.
Die Kirche war zu einem rein weltlichen Konstrukt mit pompösen Ritualen und immer feiner, immer detaillierter formulieren Regeln geworden. Gott spielte in diesem Konstrukt keine wirksame Rolle mehr; er stand nur noch als Namensgeber im Schaufenster. Gott war so beliebig geworden, dass er schließlich nur noch ein Gott neben vielen anderen war.
Wir lesen von den Propheten, dass Gott sein Volk verstoßen habe und es unter die Völker zerstreuen werde, wie es dann ja auch ca. 600 v. Chr. geschah. Ob das Urteil Gottes der Grund war oder ob das Volk durch seine Abkehr von dem einen Gott und der Wiederhinwendung zu den vielen schließlich seine Identität verlor und andere Völker daher bei der Eroberung ein viel leichteres Spiel hatten, sei dahingestellt. Sicher ist nur: Viele Götter machen offensichtlich nicht stärker als ein einziger.
Offensichtlich ist aber auch: In der Zerstreuung erkannten die Israeliten die Kraft ihres von ihnen aufgegebenen einen Gottes. Sie begannen die alte Heilige Schrift, das war vielleicht nur der Pentateuch, also die fünf Bücher Mose, neu aufzuschreiben und um Könige, Chroniken, Propheten und andere Schriften zu ergänzen, die vielleicht ursprünglich nur Bedeutung in den Einflussgebieten der jeweiligen Prophetenschulen hatten. Der jüdische Glaube wurde in der Zerstreuung reicher, als er davor jemals gewesen war.
Die alte Strukturschwäche, nämlich, dass es eine Religion der Mächtigen war, an der das Volk lediglich teilnehmen durfte, war auch nach der Rückkehr nach Jerusalem immer noch dieselbe. Der Glaube des Königs und seiner Priester entschied über den Glauben des Volkes, nicht die Beziehung des einzelnen zu Gott. In den Händen einiger weniger wurde auch dieses neue Judentum wieder zu einem Machtinstrument, zementierte so langfristig die Ferne zu Gott.
So steht am Ende des Niedergangs Johannes der Täufer. Er erklärt die gesamte Struktur für gescheitert und fordert die Umkehr zu dem einen Gott. Er spricht gleichermaßen zu Fürsten und Priestern wie zum ganzen Volk. Es geht im also nicht mehr um eine Reform der alten Kirche, er fordert und verkündet einen Neuanfang, den Gott selbst in die Wege leiten wird.
Darum endet der Täufer auch wie viele andere Propheten vor ihm: Er wird verfolgt, eingesperrt und schließlich hingerichtet.
Der Neuanfang
Jesus ist in der Wahrnehmung seiner Umwelt zunächst nur ein weiterer Lehrer. Doch er ist anders. Er spricht zum Volk und er mahnt und verdammt nicht, sondern spricht von Heilung und Erlösung jedes einzelnen, also der „kleinen Leute“. Er geht auf die alten Strukturen und die Mächtigen nur noch ein, um Dinge zu verdeutlichen, die ihm wichtig sind. Es läuft nicht richtig in Israel! Gottes Plan sieht eine persönliche Beziehung zu jedem einzelnen vor; darum predigt Jesus nicht nur vor den Mengen, er spricht auch den Einzelnen an mit den Dingen, die er sagt und vor allem den Dingen die er tut und die immer an eine konkrete Person gerichtet sind.
Jesus lehrt das Volk: Gott ist wie ein Vater; er sieht jedes seiner Kinder und gibt auf seine Wese (die wir nicht immer verstehen) jedem Kind das, was es braucht, um mit und in diesem Gott zu wachsen. Die Mächtigen können zwar über das Leibliche bestimmen, aber über das, was der Mensch sucht, seit er sich selbst erkannt hat, ist Gott der einzige König und dieser König rettet, weil er liebt. Und vor Gott sind alle Menschen gleich – gleichgroß, gleichwertvoll, einzig.
Für die Mächtigen im Land ist dieser neue Lehrer zunächst nur ein Störenfried, wie es in jener Zeit viele gab. Doch er gewinnt Einfluss, seine Reden, die Zeichen und Wunder, die von ihm ausgehen und ihm nachgesagt werden, machen ihn zu einem gefährlichen Gegner. Als es zur offenen Auseinandersetzung kommt, in der er den Priestern sagt, er werde die alte Kirche einreißen und eine neue errichten, ist sein Urteil gefällt. Es geht Jesus nicht um den Tempel in Jerusalem, man hat das sicherlich durchaus verstanden. Jesus droht, die erstarrten Strukturen einzureißen, festzementiert geglaubte Macht würde erodieren.
Jesus will Gott und Volk endlich zusammenbringen, etwas, das die Hebräer nach ihrem Auszug aus Ägypten vielleicht aus Furcht abgelehnt hatten. Jesus sagt: Die Zeit ist jetzt reif dafür, diesen Plan Gottes wahr werden zu lassen.
Die Kreuzigung, die dieser Ketzerei ein Ende setzen sollte, besiegelt aber nicht das Urteil über Jesus und seine Bewegung, sie besiegelt das Urteil über die alten Strukturen. Gott hat nicht sein Volk verworfen, er hat die Strukturen eingerissen, welche ihn von seinen Kindern getrennt hielten. Durch Jesus hat er die persönliche Beziehung eingeführt. Und durch Jesus hat dieser Gott nun ein Gesicht. Wir reden von unserem Gott, wie wir von einem Menschen reden würden, den wir kennen und dem wir vertrauen. Wir reden mit unserem Gott, wie wir mit einem Menschen reden würden, der mit uns auf dem Weg ist. Das ist die Beziehung, die Gott sich vorstellt, wenn er fragt: „Adam, wo bist du?“ Gott fragt Adam nach der Beziehung zu ihm, seinem Gott. Wo stehst du, Adam, wenn dein Gott dich ruft und dich dabei in deiner ganzen Schwachheit und Fehlbarkeit erwischt? Stehst du neben Gott, eben weil du eine lebendige, lebenspendende Beziehung zu ihm hast und auch haben möchtest, weil du ihm also vertraust, oder fliehst du, weil sich deine Beziehung zu ihm auf eine Art Unterwerfung beschränkt, gegen die du dich im Grunde auflehnen möchtest, es dich aber nicht traust?
Gott nennt uns seine Kinder und sieht in uns Freunde, Vertraute. Nur wenn wir dies auch so empfinden, haben wir eine Beziehung zu diesem Gott, die über Anbetung in Form von Ritualen und Befolgung fester Regeln hinausreicht. Nur dann kann uns ein gemeinsamer Geist führen, denn nur dann sind wir „eines Geistes“.
Gegenwart und Zukunft
Wenn wir uns die Kirche in ihrem heutigen Zustand ansehen, fragt man sich, ob Jesus nicht ein paar tausend Jahre zu früh in die Welt kam. Es gibt sie zwar die Kirche, also die Gemeinschaft der Gläubigen, als Kirche wahrgenommen wird aber eine Obrigkeit, die den Laden anführt und auch mit freilich aus der Bibel abgeleiteten, aber dennoch eigenen Regeln und Ritualen führt. Abweichung und Hinterfragen dieser Führung führt oft zu Anklage und Ausschluss aus der Gemeinschaft, in der Vergangenheit sogar oft zu Verfolgung und Hinrichtung.
Demnächst (Edit: 21.4.25) wird in der Katholischen Kirche die nächste Papstwahl anstehen. Das Konklave wird sich einmauern, bis ein neuer Papst einstimmig gewählt ist. Gewiss hat dieses Vorgehen andere Hintergründe, doch defacto wird die wahre Kirche hier ausgeschlossen; denn sie steht vor der Mauer. Die Papstwahl hat nichts mit der Kirche (im dem Sinne, wie Christus die Kirche versteht) zu tun! Damit ist die Papstwahl nur eines von vielen Zeichen, die zeigen, dass hier dieselben Strukturen am Werk sind, die schon im alten Israel wirkten. Jene Strukturen, die am Kreuz von Golgota von Gott selbst beendet wurden.
Es scheint auch, dass Gott schon wieder zahlreiche Propheten auf den Weg schickt...
Und ich frage mich: Wenn nun irgendein kleines Mönchlein irgendwie in das Konklave käme, und wenn es ausriefe: „Wählt mich zum Papst und ich werde diese Kirche einreißen und eine neue errichten!“ Was würden sie eher tun: Ihn zum Papst wählen oder ihn kreuzigen?
Und wenn es gar eine Frau wäre, die das sagt?